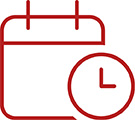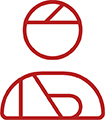Kompetenz seit 35 Jahren
Fachgebiete
Familienrecht
Was wird im Familienrecht geregelt?
Im Familienrecht geht es um familiäre Bindungen wie die Ehe und die nichteheliche Lebensgemeinschaft. Dazu gehören die Folgen einer Scheidung oder Trennung für die Partner und deren Kinder.
Das Familienrecht umfasst folglich das materielle Ehe-, Familien- und Kindschaftsrecht. Eingeschlossen sind familienrechtliche Bezüge zum Erb-, Gesellschafts-, Sozial- und Steuerrecht sowie das Recht der nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
Wobei hilft Ihr Fachanwalt für Familienrecht?
Eine Scheidung oder Trennung hat gravierende Folgen für alle Angehörigen einer ehelichen oder familiären Lebensgemeinschaft. Zu den tiefgreifenden emotionalen Turbulenzen kommt ein weitreichender Regelungsbedarf, was Güterverteilung, Versorgung der Kinder und der Eltern selbst angeht.
Als Fachanwälte für Familienrecht beraten und vertreten wir Sie in allen Fragen rund um Ehe und Lebenspartnerschaft.
Ob Ehevertrag, Unterhalt für Kinder und Ehegatten, Sorgerecht, Umgangsrecht, Vermögensauseinandersetzung oder Trennungsjahr Sie umtreiben, wir stehen Ihnen zur Seite. Stützen Sie sich auf unsere juristische Fachkompetenz und unsere lange Berufserfahrung, die uns an den diffizilsten Wendungen des Lebens hat teilhaben lassen.
Zwei Anwälte für Familienrecht tauschen sich bei Wölke & Partner regelmäßig aus. Sie bekommen also gleich zwei Mal Recht, wo es um einen Fall geht. Diese potenzierte Fachkompetenz ist ein unschätzbarer Mehrwert – ein einfacher Fall für den Kosten-Nutzen-Rechner.
Eine Scheidung, ein Anwalt?
Immer wieder konsultieren uns Ehepaare, die das Scheidungsverfahren in gegenseitigem Einvernehmen mit nur einem Rechtsanwalt führen wollen. Das ist dann möglich, wenn einer der Ehegatten dem Anwalt das Mandat erteilt und der andere sich nicht vertreten lässt.
Der Anwalt darf sowohl aus standes- als auch aus strafrechtlichen Vorschriften nicht beide Ehegatten vertreten.
Der nicht anwaltlich vertretene Ehegatte muss deshalb das Vertrauen in seinen Partner dahingehend haben, dass das Verfahren fair, kooperativ und auch unter Berücksichtigung seiner Interessen geführt wird.
In den meisten Fällen gelingt das bis zum Abschluss des Scheidungsverfahrens. Sollte es aber dennoch nicht möglich sein, eine Regelung zu finden, die beide Ehegatten akzeptieren, ist dies für den bis dahin nicht vertretenen Ehegatten problemlos. Er bricht das Verfahren ab und lässt sich selbst vertreten.
Im positiven Fall kommt es aber zu einer vertraglichen Einigung. Diese kann dann im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Familiengericht protokolliert werden. Der nicht vertretene Ehegatte benötigt aber für diese Protokollierung anwaltliche Vertretung, die in der Regel für eine angemessene Pauschalgebühr gefunden werden kann.
Gewerblich oder beruflich genutzte Räume sind niemals Ehewohnung.
Rufen Sie uns im einfach an, wenn Sie Fragen dazu haben. Sie dürfen sicher sein, dass wir klar Stellung beziehen – für Ihre Sache und nur für die Ihre.
Welche Themen gehören zum Familienrecht?